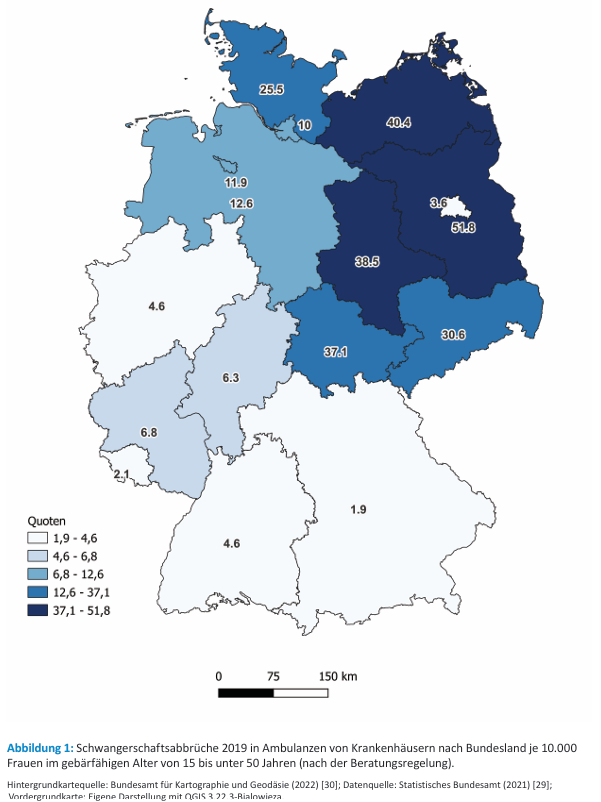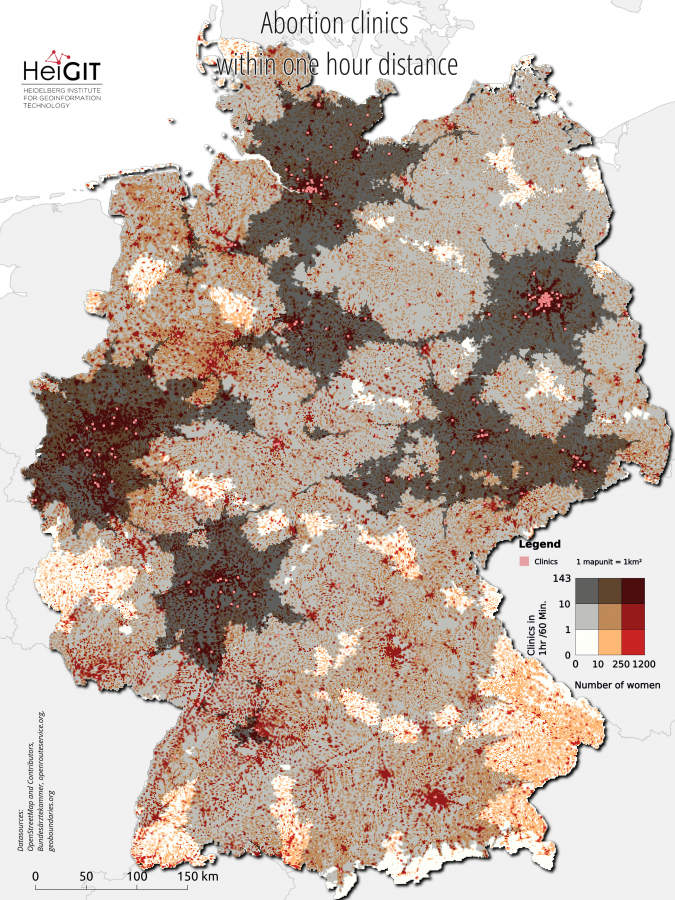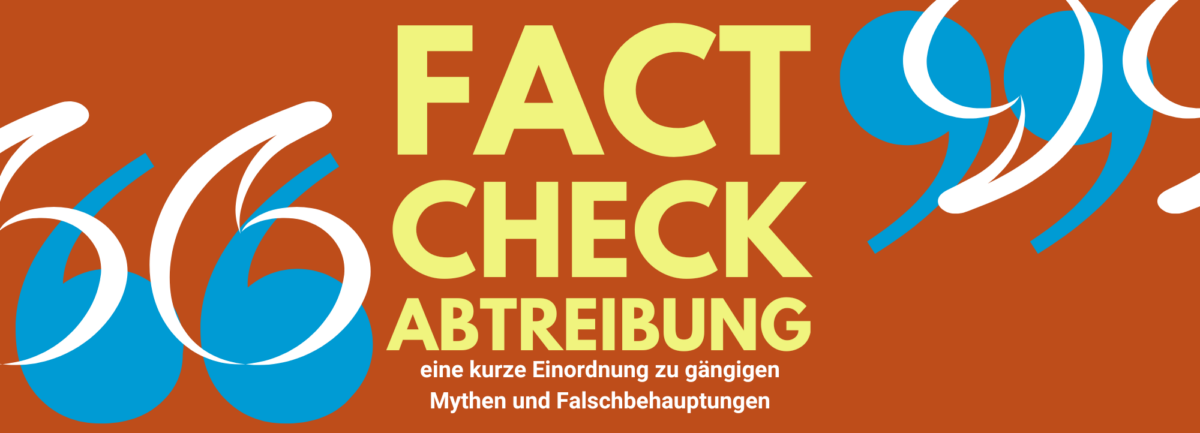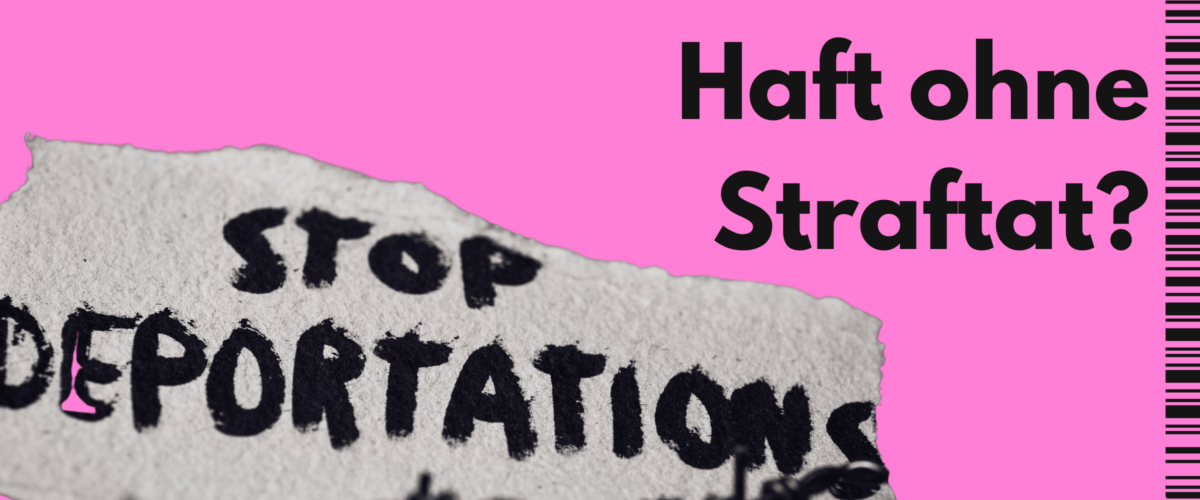TW: Im folgenden Text geht es unter anderem um (Polizei-)Gewalt, Mord, Suizidalität, Tod und Folter. Wenn du im Moment nicht in der Lage dazu bist, damit umzugehen, dann lies diesen Text (jetzt gerade) besser nicht. Überlege dir, ob du den Text besser nicht alleine, sondern in Gesellschaft von Bezugspersonen lesen möchtest.
Für die einzelnen Abschnitte findest du Triggerwarnungen spezifisch nochmal am Anfang des jeweiligen Themas, damit du diese bei Bedarf gezielt überspringen kannst.
Unterstrichene Begriffe werden im Glossar am Ende des Texts erläutert.
Warum müssen wir über Rassismus reden, wenn es um Gefängnis und Gesundheit geht?
Etwa 28% der Inhaftierten in Deutschland haben keine deutsche Nationalität, im Gegensatz zu 12% in der Allgemeinbevölkerung.
Das ist ein Ergebnis davon, dass Medien, Universitäten, Gerichte und Polizei ein gemeinsames Feindbild kreieren, das Menschen rassifiziert und kriminalisiert.
Doch wen schützt unser Justizsystem? Und wer ist nicht mit gemeint bei dieser Sicherheit?
Europäische Nationalstaaten waren und sind seit ihrer Gründung mit diskriminierender Praxis und Ideologien der Abwertung verwoben. Unsere Justiz und Polizei zeigen Muster, die noch aus Kolonialzeit und/oder dem Nationalsozialismus kommen. Hinter Inhaftierungen stehen oft rassistische Motive und die Institution Gefängnis setzt die koloniale und faschistische Unterdrückung nicht-weißer Menschen täglich fort.
Rassismus bestimmt das deutsche Justizsystem und die Exekutive und richtet damit über den Weg der Menschen bis in den Knast und darüber hinaus.
In einer Gesellschaft, in der Menschen rassistisch sozialisiert sind, müssen wir aktiv dagegenstehen und aufzeigen, welches Unrecht jeden Tag – auch und gerade von Staatshand – in Deutschland geschieht. Wir können in diesem Text nicht auf alle wichtigen Aspekte eingehen, versuchen aber, einen Einblick zu geben, inwiefern Polizeipraxis, Verurteilung, Bedingungen sowie medizinische Versorgung im Gefängnis und Gesetzgebung von Rassismus durchzogen sind.
Menschen im Knast leiden jeden Tag. Menschen im Knast erleben täglich Rassismus. Menschen im Knast werden jeden Tag medizinisch unterversorgt.
Wir müssen über Rassismus reden, weil wir sonst Knast und Medizin nicht verstehen können.
Racial Profiling
TW Polizeigewalt
Was ist Racial Profiling? – Racial Profiling bezeichnet polizeiliche Maßnahmen und Maßnahmen von anderen Sicherheits-, Einwanderungs- und Zollbeamt_innen, wie Identitätskontrollen, Befragungen, Überwachungen, Dursuchungen oder auch Verhaftungen, die nicht auf einer konkreten Verdachtsgrundlage oder Gefahr (etwa dem Verhalten einer Person oder Gruppe), sondern allein aufgrund von („äußeren“) rassifizierten oder ethnisierten Merkmalen – insbesondere Hautfarbe oder (vermutete) Religionszugehörigkeit – erfolgen. Oft sind hier auch Verschränkungen mit weiteren Ungleichheitsdimensionen wie Geschlecht, sozio-ökonomischem Status, legalem Status, Sexualität, Be_hinderung, Sprache und Lebensalter zu verzeichnen. (https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/migration-und-sicherheit/308350/racial-profiling-institutioneller-rassismus-und-interventionsmoeglichkeiten/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2023)
Dass Racial Profiling ein gefährliches und vielgenutztes Werkzeug der Polizei ist, ist gemeinhin bekannt. Doch woher kommt die Selbstverständlichkeit, mit der Racial Profiling praktiziert wird? Erschreckenderweise liegen die Wurzeln von Racial Profiling in aller Deutlichkeit in der deutschen Verfassung. Laut Gesetz ist es der Bundespolizei, welche als Erstkontrollinstanz das größte Ausmaß an Racial Profiling zu verantworten hat, verboten, unveränderliche äußere Merkmale als Auswahlkriterium für eine „anlasslose“ Kontrolle heranzuziehen. Das Bundespolizeigesetz jedoch ermächtigt Beamt*innen der Bundespolizei, Menschen für ihre Kontrollen zu selektieren – wobei diese nicht „anlasslos“ sind. Der Anlass ist die Rassifizierung der Betroffenen. Der Anlass wird jeden Tag symbolisch von allen Menschen getragen, die nicht weiß gelesen werden. Dieser Anlass kann weder abgestreift noch verändert werden und kostet viele das Leben.
Dass systematisch nur das äußere Erscheinungsbild der Bürger*innen herangezogen wird, obwohl das deutsche Grundgesetz dies ausdrücklich verbietet, liegt am ursprünglichen Zweck der Norm. Diese Normen sollten den Wegfall innereuropäischer Grenzkontrollen ausgleichen. Es wird der Bundespolizei also erlaubt, „anlasslos“ zu kontrollieren, um illegale Zuwanderung zu begrenzen. Damit suggeriert das Gesetz, dass der Aufenthaltsstatus eines Menschen am Aussehen festgemacht werden kann und ist somit eine legale Grundlage für Racial Profiling – eine Form der Diskriminierung, die gezielt BIPoC in ihrem täglichen Leben angreift und gefährdet. Unter Racial Profiling fallen jedoch nicht „nur“ die Kontrollen eines potentiell illegalen Aufenthaltes. Tatsächlich führt die gezielte Selektion und Diskriminierung von BIPoC aufgrund von äußeren Merkmalen, wie z.B. Gesichtszügen und Hautfarbe zur systematischen Aufrechterhaltung einer Scheinkorrelation zwischen BIPoC und strafbarem Verhalten. Denn warum sonst sollte die Polizei einen Menschen anhalten und kontrollieren? Dieser Mensch muss sich verdächtig gemacht haben. Hinter jeder Kontrolle steckt für Beobachtende somit eine starke bildliche Symbolik – die mehrheitlich weißen Polizist*innen kontrollieren die im Vergleich zu weißen Personen vermeintlich kriminelleren BIPoC. Genau dieses Szenario erlaubt nicht nur die verfassungsrechtliche, sondern auch eine gesellschaftliche Manifestation von Racial Profiling. Besonders äußert sich dies im Anzeigeverhalten von Bürger*innen. Junge, männlich gelesene BIPoC werden viel öfter bei der Polizei angezeigt als weiße Personen. Dies verstärkt wiederum fatalerweise das Vorurteil, BIPoC seien häufiger kriminell, und in der Konsequenz das Grundproblem – gesellschaftlichen Rassismus. Das Konzept von Racial Profiling wird also weit über seine ursprüngliche verfassungsrechtliche Legitimation der Erfassung von Menschen mit illegalem Aufenthaltsstatus praktiziert. Der Afrozensus erhob, dass über die Hälfte von 6000 Befragten schon einmal anlasslos kontrolliert worden sind. In einer Befragung im Rahmen eines Forschungsprojekts gab etwa die Hälfte der Befragten an, hinter den anlasslosen Kontrollen ihren ethnischen und/oder kulturellen Background zu vermuten. Ganze 62% der befragten BIPoC gaben an, sich in polizeilichen Gewaltsituationen diskriminiert zu fühlen – bei Menschen ohne Migrationshintergrund waren es gerade einmal 31%.
Racial Profiling ist auch im Jugendstrafrecht ein Problem. In Zusammenarbeit von Polizei und Universitäten zur Auslegung von Kriminalstatistiken werden sogenannte Intensivtäter*innen identifiziert. Dabei werden künstliche Täter*innen-Gruppen konstruiert, die vermeintlich viele Straftaten begehen, um diese Taten dann früh und hart zu verhindern.
Durch die Schaffung eines Feindbildes von „kriminellen und ausländischen Jugendlichen“ werden junge Menschen und ihre Communitys stigmatisiert und brutalisiert. Dadurch werden Personen, die nicht unbedingt viel straffällig werden, allein durch die Zuordnung zu dieser Gruppe intensiv verfolgt und besonders von der Ermittlungsbehörde beobachtet. Sie erleben also schon früh Kontakt mit Repressionen und Stigmatisierung.
Die Zuordnung zu diesen Gruppen wird mit sozialer Benachteiligung erklärt, passiert aber ganz klar auf der Basis von Rassismus und ist ein Paradebeispiel von Racial Profiling. Hierbei gehen Justiz, Polizei und Universitäten Hand in Hand, ohne dass Rassismus in der Kriminalpraxis und Forschung thematisiert wird.
Death in Custody
TW: Tod durch rassistische Polizeigewalt
Aber Rassismus führt noch viel weiter! BIPoC sind in ungleichem Maße von institutioneller Gewalt betroffen und häufig erleben die Betroffenen Mehrfachdiskriminierungen, die schwere Folgen haben können. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben ein besonders hohes Risiko, in staatlicher „Obhut“ ums Leben zu kommen, denn sie sind generell häufiger von Polizeimaßnahmen betroffen. Außerdem eskalieren die Interaktionen mit der Polizei häufiger, da internalisierte rassistische Denkmuster zu einer niedrigeren Hemmschwelle für Gewaltanwendung führen. Ein weiterer Grund ist die Existenz von sowohl Straftaten, die nur Menschen ohne deutschen Pass begehen können („illegale Einreise“ oder „illegaler Aufenthalt“), als auch Haftnormen, die nur Menschen ohne deutschen Pass betreffen (z.B. Abschiebehaft).
„Aktuell wissen wir von 225 Todesfällen von Schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Personen in Gewahrsam und durch Polizeigewalt in Deutschland seit 1990“ (Bündnis „Death in Custody“, https://doku.deathincustody.info/, Stand: 27.06.2023).
Diese Todesfälle werden häufig nicht aufgeklärt und es kommt fast nie zur Bestrafung der Polizist*innen oder JV-Beamt*innen. Hauptursache der Todesfälle in Haft oder Gewahrsam sind dabei Gewaltanwendungen wie Erschießung oder physische Gewalt. Danach folgt Suizid, wobei sich hier die Schuldfrage stellt und uns der Fall Oury Jalloh noch deutlicher gemacht hat, dass wir hinterfragen müssen, ob dies nicht als Deckmantel für illegale Gewaltanwendung missbraucht wird.
„Bemühungen nach Aufklärung stoßen bei Polizei und Justiz auf Abwehr. Die Verzerrung der Geschehnisse zum Schutz von Polizeibeamt:innen und Mitarbeiter:innen in Einsperrinstitutionen, die gegebenenfalls in die Vorfälle verwickelt oder gar Täter:innen sind, wirft Fragen auf: Wer zählt in der Gesellschaft? Wessen Leben, wessen Tod sind von Relevanz? Wer hat Zugang zu Recht und Gerechtigkeit?“ (Bündnis „Death in Custody“)
Deshalb unterstützen wir die Forderungen von Death in Custody: Täter*innen müssen zur Verantwortung gezogen werden! Dafür braucht es zum Beispiel unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen. Wir brauchen Solidarität mit den Angehörigen anstelle von Kriminalisierung der Getöteten! Kontrollen dürfen nicht anlasslos und auf Basis von Racial Profiling passieren! Wir müssen strukturellen Rassismus in der Polizei und im Gefängnis anerkennen!
Denn: RASSISMUS TÖTET!
Rassistische Medizin im Knast
Um den Zusammenhang zwischen Rassismus und der medizinischen Versorgung im Gefängnis verstehen zu können, müssen wir uns zunächst anschauen, warum das medizinische System rassistisch ist.
In allen Bereichen der Gesundheitsversorgung inklusive der medizinische Ausbildung berichten Betroffene von Rassismuserfahrungen. Dies zeigt sich unter anderem in der individuellen Diskriminierung von Patient*innen durch medizinisches Personal, Rassismus findet sich jedoch auch in institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen wieder. In der medizinischen Ausbildung wird sich an rassistischen Wissensbeständen und Stereotypen bedient, die in der theoretischen und klinischen Lehre vermittelt werden. So ist die medizinische Lehre auf weiße cis-männliche Patienten mittleren Alters ausgerichtet, kulturspezifische und ethnische Aspekte der Medizin werden zu wenig in Betracht gezogen. Erst seit Ende der 90er-Jahre beinhaltet der Lernzielkatalog für Medizin überhaupt kulturelle Begriffe, transkulturelle Kenntnisse und die Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Krankheiten in der medizinischen Lehrausbildung. Viele reguläre Lehrbücher beinhalten noch veraltete, rassistische Referenzwerte, die in der Diagnostik und Therapie verwendet werden und überdacht werden müssen. Bei Dozierenden herrscht oft eine mangelnde Sensibilität für rassistische Stereotype und Kategorisierungen und deren unkritische Verwendung.
Besonders im Bereich der Schmerzbeurteilung prägen rassistische Vorurteile die medizinische Behandlung. Eine US-amerikanische Studie aus der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ zeigte, dass Afroamerikaner*innen bis zu 57 Prozent weniger Schmerzmedikation erhalten als andere Patient*innengruppen. Häufig werden die Schmerzsymptome von BIPoC als Simulation gedeutet und nicht ernst genommen. In der Notfallmedizin entstehen Risiken für nicht-weiße Menschen, da durch Unkenntnis und fehlende sensible Lehre das Erkennen von Hautveränderungen und Blutergüssen sowie die Suche nach Venen und das Legen eines Zugangs Schwierigkeiten darstellen.
Diese unsensible, rassistische medizinische Lehre spiegelt sich auch in der Behandlung in den Gefängnissen wider. Die medizinische Versorgung der Menschen im Gefängnis basiert also auf dem Unwissen der Behandelnden für eine geeignete Versorgung von rassifizierten Gruppen. Zudem gibt es keine Fortbildungen für Ärzt*innen, die in Gefängnissen arbeiten, und dementsprechend sensibilisiert werden könnten.
Die medizinische Versorgung im Gefängnis ist rassistisch.
Dadurch, dass es im Gefängnis keine freie Ärzt*innenwahl gibt, sind Inhaftierte der durch Vorurteile und Diskriminierung geprägten medizinischen Willkürbehandlung ausgeliefert, ohne die Option auf eine andere behandelnde Person zu haben.
Aufgrund des Mangels an medizinischem Personal in Gefängnissen werden medizinische Maßnahmen zum Teil von ungeschultem Gefängnispersonal durchgeführt. Beim Wachpersonal herrscht ein fehlendes Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Maßnahmen, die Sicherstellung regelmäßig verordneter Medikamente ist nicht gewährleistet und häufig werden Inhaftierten aus rassistischen Gründen Medikamente verweigert. Hinzu kommt, dass die Beziehung zwischen Wachpersonal und Inhaftierten einem Machtungleichgewicht unterliegt, das durch die Abhängigkeit der Gefangenen von der fachlichen und sozialen Kompetenz des Gefängnispersonals verschärft wird.
Ein weiteres gravierendes Problem sind mögliche Sprachbarrieren: Bei einem hohen Anteil an Menschen mit wenig Deutschkenntnissen in deutschen Haftanstalten verhindern Kommunikationsschwierigkeiten den Zugang zu Gesundheitsversorgung, da es keinen einfachen Zugang zu Dolmetscher*innen in Knästen gibt. Patient*innen können gleichzeitig erschwert auf eigene Ressourcen zur Sprachmittlung wie Familienangehörige zurückgreifen.
Bei Inhaftierten mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus zeigen sich weitere Schwachstellen in der medizinischen Versorgung: Bei unklarem Aufenthaltsstatus ist die medizinische Behandlungskontinuität erschwert, da die Finanzierung nach Haftende ungeklärt ist. Zusätzlich werden Vollzugslockerungen und Entlassungsvorbereitungen nur eingeschränkt durchgeführt.
Wir fordern:
Rassistische Stereotype und Kategorisierungen dürfen nicht Teil der medizinischen Lehre sein.
Die Gesundheitsversorgung im Gefängnis darf nur von geschultem und sensibilisiertem medizinischen Personal durchgeführt werden.
Es muss einen einfachen und schnellen Zugang zu Sprachmittlung für eine optimale Versorgung aller Menschen in Gefängnissen geben.
Die medizinische Versorgung muss im Gefängnis und außerhalb der Mauern frei von Rassismus und Diskriminierung sein!
Abschiebehaft – Haft ohne Straftat
TW Suizid, Tod, Folter, Gewalt
Angesichts ihrer drohenden Abschiebung töteten sich mindestens 300 Menschen in den Jahren 1997 bis 2017 selbst oder starben beim Versuch, vor ihrer Abschiebung zu fliehen. 87 dieser über 300 Personen befanden sich in (Abschiebe-)Haft.
„All diese Todesfälle sind den politisch Verantwortlichen bewusst. Sie sind ein Teil der Abschiebeindustrie, den sie wissentlich und willentlich in Kauf nehmen. Sie sind ein Teil des deutschen Asylsystems, das Menschen zum Warten zwingt und ihnen darin Vieles aufbürdet: Zermürbung, Unsicherheit, Depression, Ängste.“ (Lübecker Flüchtlingsforum e.V. (2020). Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo! http://glueckstadtohneabschiebehaft.blogsport.eu/files/2020/08/broschuere_web.pdf)
Im folgenden Abschnitt geht es um explizite Gewalt und Schilderungen von Suizidalität. Überlegt euch gut, ob ihr dies gerade lesen möchtet. Wenn das nicht der Fall ist, springt gerne zum nächsten Abschnitt, der mit „Die Geschichte von Herrn H. ist kein Einzelfall“ beginnt.
Unter den menschenunwürdigen Bedingungen in Abschiebehaft litt auch Herr H., der 3 Monate im Abschiebeknast in Büren, NRW, inhaftiert war und über den die analyse & kritik 2020 berichtete. Trotz schwerer psychischer Erkrankungen und Suizidalität fand seine Abschiebung nach Marokko statt. Er selbst berichtet von erschreckenden Zuständen während seiner Haftzeit: Statt adäquater psychiatrischer Behandlung wurde Herr H. nach einem Suizidversuch an Händen und Füßen gefesselt ins Krankenhaus gebracht und zurück in Haft isoliert. Ihm wurden Grundbedürfnisse verweigert und mit dem „Keller“ gedroht: Dabei handelt es sich um Isolationszellen, in denen durchgängig Musik gespielt wird. Das entspricht einer gängigen Foltermethode. Aufgrund seiner Suizidalität begleitete ein Arzt Herrn H. im Abschiebeflieger, zusätzlich war er im Flugzeug an Händen, Füßen und Rumpf fixiert. Der Arzt drohte Herrn H. bei Widerstand wiederholt mit Beruhigungsspritzen.
Der Fall zeigt medizinisches Versagen und ärztliche Mitschuld im rassistischen Abschiebesystem.
Die Geschichte von Herrn H. ist kein Einzelfall. Der Komplex der Abschiebeknäste ist schon innerhalb seines Rechtsrahmens menschenunwürdig – Rechtsbrüche durch die Haftanstalten und während der Inhaftierung sind zusätzlich weit verbreitet.
Abschiebehaft bezeichnet den Freiheitsentzug durch die Ausländerbehörde oder die Bundespolizei vor der Abschiebung. Menschen werden also inhaftiert, nicht weil sie eine Straftat begangen haben, sondern um dem Staat den Verwaltungsakt der Abschiebung zu erleichtern. Diese Praxis existiert so oder so ähnlich seit 1919 und steht in antisemitischer und rassistischer Tradition.
Ein „begründeter Verdacht“, dass eine Person sich ihrer Abschiebung entziehen möchte, ist für eine Inhaftierung ausreichend. In der Praxis führt das zu mitunter absurden Begründungen – etwa, dass Personen nicht zu Hause angetroffen werden oder äußern, dass sie nicht in ihr Herkunftsland zurück möchten. Ob die Inhaftierung rechtens war, stellt sich oft erst nach der Abschiebung heraus: Zwischen 2015 und 2017 wurden im Abschiebeknast in Büren 221 Abschiebungsverfahren durch einen solidarischen Verein begleitet. Von diesen Verfahren waren Stand 2018 insgesamt 119 rechtskräftig abgeschlossen, in 60% der Fälle war die Inhaftierung rechtswidrig.
Da die Gefangenen keine Straftäter*innen sind, dürfen sie auch nicht gefängnisähnlich untergebracht werden. Die Realität sieht jedoch anders aus: In vielen Haftanstalten sind vor allem während der letzten Jahre die Bedingungen verschärft worden. Konkret heißt das: Gefängniszäune mit NATO-Draht, ausgeweitete Videoüberwachung, Verbot von Handybesitz, verlängerte Einschlusszeiten, weniger Hofgang und Zellen mit abschließbaren, schalldämmenden Fenstern.
Die medizinische Versorgung ist vor allem psychiatrisch mangelhaft, es fehlen Dolmetscher*innen und das Personal ist nicht geschult im Umgang mit fluchtbedingten Traumata.
Bis zu 1,5 Jahre kann die Haft andauern, wobei die genaue Länge willkürlich von Verwaltungsakten abhängt. Gleichzeitig tragen die Inhaftieren die Kosten selbst – in Büren sind das 240€ pro Tag (Stand 2017).
Der Abschiebeknast in Büren ist mit 175 Haftplätzen der größte Abschiebeknast Deutschlands und liegt ganz in der Nähe von Köln. Regelmäßig berichten Betroffene von unwürdigen Bedingungen. Dazu gehören willkürliche Einzelhaft in Isolation ohne rechtliche Grundlage und ohne Beschwerdemöglichkeit für die Inhaftierten, erniedrigende Durchsuchungen mit kompletter Entkleidung, permanente unverpixelte Kameraüberwachung aller Räume inklusive der Toiletten und extreme Bestrafung bei willkürlich definiertem „Fehlverhalten“. Auch der oben beschriebene Fall von Herrn H. spielte sich in der Haftanstalt in Büren ab. Die nationale Stelle zur Verhütung von Folter berichtete 2018, die Lebensbedingungen in Büren seien unhaltbar und ein massiver Eingriff in die Grund- und Persönlichkeitsrechte.
Inhaftierte in Abschiebeknästen stehen unter massiver psychischer Belastung. Ihre Zukunft ist unsicher, es ist nicht klar, wann und ob die Abschiebung droht und was sie im Herkunftsland erwartet – bei oft bereits traumatischer Fluchtgeschichte. Dabei fehlt häufig psychologische Betreuung. Der Knast fängt nicht auf, sondern (re-)traumatisiert Betroffene.
„Bei den Menschen, die durch das deutsche Asylsystem in solch entwürdigende Lebenssituationen gezwungen werden, handelt es sich um Menschen auf der Suche nach einem sicheren und guten Leben. Deshalb müssen Einrichtungen wie der Abschiebeknast in Büren mit seinen Foltermethoden und Erniedrigungen aus der Deckung gesellschaftlicher Akzeptanz geholt, das System, das solch eine Praxis kreiert, muss abgeschafft werden.“ (Ausbrechen Paderborn und AK Asyl Göttingen und Witzenhausen (2020). Die Abschiebung des Herrn H. analyse & kritik https://www.akweb.de/gesellschaft/die-abschiebung-des-herrn-h/)
Wir fordern:
- Pflichtanwält*innen für jede Person, die in Abschiebehaft kommt
- Zugänge für NGOs zu den Abschiebegefängnissen
- einen Baustopp neuer Abschiebeknäste
- vollwertige medizinische und psychologische Versorgung Inhaftierter
Doch selbst der schönste Abschiebeknast bleibt rassistische Unterdrückung: Weg mit Grenzen, lasst uns Abschiebungen stoppen und Abschiebeknäste abreißen!
NO BORDER, NO NATION, STOP DEPORTATION!
Glossar
- Afrozensus: Der Afrozensus ist die erste umfassende Studie, die sich mit den Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen und Perspektiven Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland befasst. Die Ergebnisse wurden 2020 erhoben und 2021 veröffentlicht. (https://afrozensus.de/, zuletzt aufgerufen am 07.07.2023)
- BIPoC: Abkürzung für „Black, Indigenous and People of Color“ (auf deutsch: Schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color (wird nicht übersetzt))
- cis: „‚Cis‘ ist das Gegenstück zu ‚trans‘. ‘Cis‘ wird benutzt, um auszudrücken, dass eine Person das Geschlecht hat, dem sie bei der Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen wurde.“ (queer-lexikon.net, zuletzt aufgerufen am 07.07.2023)
- Oury Jalloh: Oury Jalloh starb am 07.01.2005 im Alter von 36 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle. Die Justiz stellt seinen Tod als Selbstmord da, es gibt aber zahlreiche Gutachten und Beweise dafür, dass dies nicht stimmen kann. Es wird vermutet, dass Polizist*innen Oury Jalloh aus rassistischen Gründen ermordeten. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt, 2019 wurde das Verfahren offiziell eingestellt. (https://doku.deathincustody.info/cases/2005-01-07-oury-jalloh-12-238513879551425/* (zuletzt aufgerufen am 07.07.2023), mehr Infos unter https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/) *
- Rassifizierung: Rassifizierung bezeichnet die Konstruktion von „Rassen“ durch Kategorisierung, Homogenisierung und Hierarchisierung von Menschen auf der Grundlage ausgewählter Merkmale wie Hautfarbe, Sprache oder Religion. Dem Merkmal wird eine existenzielle Bedeutung zugeschrieben und zugleich wird es als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Gruppen begriffen. (https://rise-jugendkultur.de/glossar/rassifizierung/ (zuletzt abgerufen am 10.07.2023))
Quellen
Quellen Einleitung
Quellen Racial Profiling
- Abdul-Rahman, Laila; Grau, Hannah Espín; Klaus, Luise; Singelnstein, Tobias (05/2023). Übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung (KviAPol). Goethe Universität Frankfurt am Main. https://kviapol.uni-frankfurt.de/images/pdf/Zusammenfassung%20Gewalt%20im%20Amt.pdf
- Aikins, Muna AnNisa; Bremberger, Teresa; Aikins, Joshua Kwesi; Gyamerah, Daniel; Yıldırım-Caliman, Deniz (2021). Afrozensus 2020: Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland, Berlin. Afrozensus. https://afrozensus.de/reports/2020/Afrozensus-2020-Einzelseiten.pdf#page=224
- Brazzell, Melanie: Was macht uns wirklich sicher? (2018)
- Cremer, Hendrik (06/2013). Racial Profiling – menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach §22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz. Deutsches Institut für Menschenrechte. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Racial_Profiling_Menschenrechtswidrige_Personenkontrollen_nach_Bundespolizeigesetz.pdf
- Death in Custody (letztes Update 2023). https://doku.deathincustody.info/ (abgerufen: 05.07.2023)
- Deutsches Institut für Menschenrechte. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/racial-profiling-menschenrechtswidrige-personenkontrollen-nach-22-abs-1-a-bundespolizeigesetz (abgerufen am 08.07.2023)
- Dziedzic, Paul (2020). Kultur der Straflosigkeit. analyse & kritik https://www.akweb.de/ausgaben/661/death-in-custody-todesfaelle-in-polizeigewahrsam/ (abgerufen: 05.07.2023)
Quellen Rassismus in der Knastmedizin
Quellen Abschiebehaft